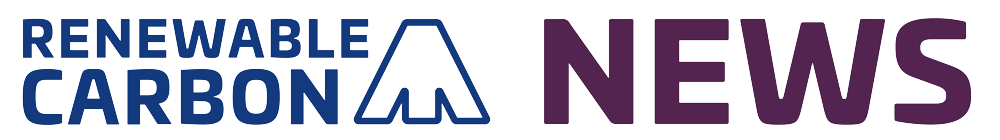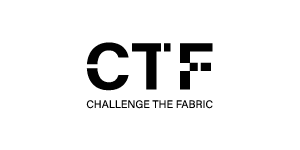Wenn Ingenieure biologische Konstruktionsprinzipien aufgreifen, dann meist um sie in eine evolutionäre Technik zu übersetzen. Nicht nur im Großen, sondern auch in kleinsten Dimensionen könnte dies bald zu neuartigen Anwendungen führen: Mikro- oder nanostrukturierte Biomaterialien sollen so zum Vorbild für neue Werkstoffe werden. “Natürliche Materialien sind raffiniert aufgebaute Verbundwerkstoffe, die viele interessante Eigenschaften in sich vereinen. Nehmen Sie zum Beispiel Perlmutt aus Muschelschalen. Es ist besonders hart, fest und zugleich enorm zäh. Solche Stoffe nach dem Vorbild von Biomineralien sind technisch vielseitig einsetzbar”, sagt Joachim Bill, Materialwissenschaftler an der Universität Stuttgart.
Unter dem Mikroskop wird das Geheimnis des Perlmutts offenbar: Es ist aus vielen Schichten einer bestimmten Form von kristallinem Kalziumkarbonat aufgebaut. In jeder Schicht lappen winzige, sechseckige Aragonitkristalle wie Dachziegel übereinander. Die einzelnen Lagen hält eine dünne Schicht Biokleber zusammen. “Dadurch sind Muschelschalen 3.000 Mal bruchfester als reine Aragonitkristalle”, sagt Bill. Sein Team hat eine Art künstliches Perlmutt auf der Basis von Titandioxid entwickelt. Diesen bionisch inspirierten, extrem kratzfesten Werkstoff brachte er auf eine Kunststoffoberfläche auf. “Ein namhafter Badewannenhersteller will unser Verfahren vielleicht sogar übernehmen”, sagt Bill. Noch sei es aber Grundlagenforschung.
Die Forscher planen bereits den nächsten Coup: Natürliche Biomineralien sind für die Industrie kaum nutzbar. Deshalb sollen die für die Biomineralisation verantwortlichen Gene verändert werden. So sollen die gewünschte Form, Größe und chemische Zusammensetzung des Werkstoffes erhalten werden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert diese Forschung mit rund zwei Millionen Euro jährlich. In sechs Jahren sollen die Materialforscher, die mit drei weiteren Instituten zusammenarbeiten, Ergebnisse vorweisen.
Derzeit arbeitet das Stuttgarter Team daran, besondere Oxidkeramiken von Viren herstellen zu lassen. Dabei fiel die Wahl auf Zinkoxid. Aus ihm werden lichtdurchlässige elektrisch leitende Schichten hergestellt, die als Kontakte an Leuchtdioden, Solarzellen oder Flüssigkristallbildschirmen eingesetzt werden. Zink ist ein in lebenden Organismen wichtiges Spurenelement mit vielen biologischen Aufgaben. “Wir wollen die genetischen Regulationsmechanismen von Modellorganismen so verändern, dass uns der Stoff in geeigneter Weise zur Verfügung steht”, sagt Bill. Vorerst sorgt noch ein Virus für die besondere Strukturierung des Werkstoffes.
Tabakmosaikviren befallen Pflanzen und manipulieren deren Gene so, dass deren Blätter sich mosaikartig verfärben. Im Labor aber übernimmt das Virus die Aufgabe eines Katalysators. Gibt man die Viruspartikel in eine übersättigte Metallsalzlösung aus Zinknitrat, so fällt das begehrte Zinkoxid aus und bildet dabei regelmäßige Strukturen. Je nachdem, wie die Forscher die Zusammensetzung der Virusproteine verändern, setzen sich die Zinkoxidkristalle in verschiedenartig strukturierten Schichten ab. Manche davon erinnern an einen Schwamm, andere sehen aus wie ein kurz geschorener Rasen. “Wir können speziell strukturierte Lagen im Mikro- und Nanometerbereich erzeugen, die unterschiedliche Werkstoffeigenschaften besitzen”, sagt Bill.
Auch die synthetische Biologie verbindet biomolekulare Abläufe mit Konzepten der Ingenieure. Dabei dienen, ähnlich wie in der Biotechnik, biologische Zellen als “Minifabriken”. Spezielle Manipulationen bringen sie dazu, Verbindungen herzustellen, die es in Natur gar nicht gibt: “Code Engineering” nennt Nediljko Budisa, Leiter der Forschergruppe Molekulare Biotechnologie am Max-Planck-Institut (MPI) für Biochemie in Martinsried, die genetischen Tüfteleien. Sie treiben gewöhnliche Mikroorganismen dazu, Eiweißverbindungen zu erzeugen, die das Leben noch gar nicht erfunden hat. Mithilfe dieser künstlichen Proteine könnte die Industrie künftig Kunststoffe umweltschonend und effizienter herstellen. Eingesetzt in Waschmitteln, wären die synthetischen Proteine zehn Mal wirksamer als herkömmliche Fettlöser.
Angefangen hat alles als Spielerei. In den 60er-Jahren begannen Genforscher, mit Aminosäuren zu experimentieren. Sie wollten herausfinden, wie die Natur Eiweiße zusammensetzt und welche Wirkung es hat, wenn deren Konstruktionspläne abgeändert werden. Eiweiße sind die Hauptakteure im Körper: Sie transportieren Stoffe, übermitteln Botschaften oder führen als molekulare Maschinen lebenswichtige Prozesse aus. Die “Steuermänner der Zelle” werden aus Aminosäuren aufgebaut, deren Abfolge in der Erbinformation festgelegt ist. Auch die Übersetzung dieser Information während der Bildung von Proteinen wird durch den genetischen Code bestimmt.
“Alle Lebewesen nutzen einen Standardsatz von 20 verschiedenen Aminosäuren, aus denen die Proteine gebildet werden”, sagt Lars Merkel aus dem Team von Budisa. Doch die Natur benutzt nur ein enges Repertoire der theoretisch möglichen Aminosäuren. “Es fehlen viele Aminosäureverbindungen, die beispielsweise Atome wie Fluor, Chlor, Brom oder Silizium enthalten”, sagt Merkel. Das Leben fand dafür keinen Nutzen. Mit diesen Bausteinen ließen sich jedoch neue therapeutische Proteine oder industriell relevante Enzyme herstellen.
Dem Ziel sind die MPI-Forscher nun näher gekommen. Im Labor haben sie mehrere neue Aminosäuren hergestellt, darunter auch eine, die das Element Fluor enthält. Wie aber lassen sich die künstlichen Bausteine in ein Zielprotein übertragen, um es so für eine bestimmte Anwendung abzuändern? Einen Konstruktionsplan, auf den die Forscher zurückgreifen könnten, hat die Natur nie entwickelt. Also versuchen sie es mit einem Kniff. Dafür kommen Darmbakterienstämme zum Einsatz, die nicht in der Lage sind, einige der 20 natürlichen Aminosäuren selbst herzustellen. Die Mikroben müssen die fehlenden Aminosäuren deshalb aus dem Nährmedium aufnehmen. Sind sie aufgebraucht, stellen sich die Bakterien auf Entzug ein; sie akzeptieren dann auch ähnlich aufgebaute Verbindungen. Dann geben die Forscher zunächst geringe Mengen beispielsweise einer fluorhaltigen Aminosäure in die Nährlösung. Dabei zeigen sich einige der Mikroben nicht besonders wählerisch. Sie übernehmen den künstlichen Baustein, bauen ihn in das Zielprotein ein und vermehren sich sogar. “Beim Einbau übertragen die synthetischen Aminosäuren ihre Eigenschaften auf die Proteine”, sagt Merkel. Mittlerweile können die Forscher in einem einzigen Experiment gleichzeitig drei verschiedene Aminosäuren durch künstliche ersetzen.
“Damit könnten bald völlig neue Produktklassen, deren biochemische Synthese bislang nicht möglich war, erschlossen werden”, sagt Merkel. So lassen sich mithilfe von fluorhaltigen Proteinen Katalysatoren maßschneidern, die in organischen Lösungsmitteln ebenso gut arbeiten wie in Wasser. “Das funktioniert so ähnlich wie bei der Teflonpfanne, bei der eine Fluorbeschichtung dafür sorgt, dass weder Wasser noch Fett anhaftet”, erklärt Merkel. Die Industrie könnte solche Katalysatoren gut gebrauchen. Kunststoffe, die Fluor enthalten, müssen heute noch in energieaufwendigen Prozessen chemisch hergestellt werden. Dank der neuen Methode könnten fluorhaltige Biokunststoffe künftig umweltschonender und billiger produziert werden.
Source
Welt online, 2011-01-05.
Supplier
Share
Renewable Carbon News – Daily Newsletter
Subscribe to our daily email newsletter – the world's leading newsletter on renewable materials and chemicals