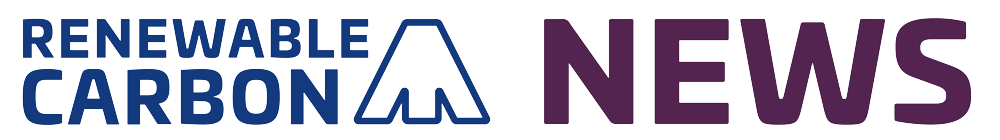In rund fünfzig Jahren werden nach Schätzung von Experten die Erdölvorräte aufgebraucht sein. Zumindest jene, die sich aus heutiger Perspektive noch rentabel gewinnen lassen. Dann wird es interessant. Immerhin braucht man Öl nicht allein zum Heizen oder als Treibstoff. Tausende von Alltagsgegenständen sind letztlich aus Öl gemacht – Kunststoffe, Farben, Lacke und vieles mehr. Wie also geht es weiter, wenn die fossilen Lagerstätten leergepumpt sind?
Die Zukunftsvision klingt beinahe phantastisch. Eine Vielzahl chemischer Produkte soll zukünftig aus Biomasse in sogenannten Bioraffinerien entstehen: Garn für T-Shirts, Zutaten für Kunststoffe, Lösungsmittel, Schmierstoffe und sogar Nylon. Damenstrümpfe aus Dinkelstroh?
Was nach dem Werbegag eines Kompost-Herstellers klingt, hat durchaus einen wissenschaftlichen Hintergrund. Eine ganze Reihe von Forschern hat in den vergangenen Jahren Verfahren entwickelt, mit denen sich Pflanzen- und feuchte Küchenabfälle, Holzreste oder Stroh wirtschaftlich in wichtige Basischemikalien verwandeln lassen – in chemische Zutaten für hochwertige Produkte. Nach dem Vorbild petrochemischer Anlagen konzipieren sie ihre Bioraffinerien. Wichtiger Unterschied: Statt des Erdöls wird in den grünen Chemiewerken mit der Biomasse ein nachwachsender Rohstoff verbraucht. (Vgl. Meldung vom 2003-03-03.)
Birgit Kamm gehört zu den Wissenschaftlern, die die Bioraffinerie-Idee in Deutschland vorantreiben. Gemeinsam mit mehreren Forschungseinrichtungen und Firmen baut die Direktorin des “Forschungsinstituts Bioaktive Polymersysteme” (BIOPOS) aus Teltow in Brandenburg derzeit eine der ersten deutschen Bioraffinerien auf. Im kommenden Jahr soll der Betrieb beginnen.
Das erste Etappenziel: Die Bioraffinerie wird an eine schon bestehende Trocknungsanlage für Wiesenschnitt und Grünabfälle gekoppelt, die Biomasse in Saft und Trockenmasse trennt. Aus dem Saft sollen unter anderem wertvolle Eiweiße gewonnen werden. Die Trockenmasse, der sogenannte Presskuchen, soll beispielsweise als Rohstoff zur Papierherstellung verkauft werden. Das klingt freilich noch nicht nach Hightech-Chemie. “Kein Problem”, sagt Kamm, “unser Ziel ist es, die Anlage nach und nach zu erweitern und immer vielfältigere Produkte zu schaffen.”
Eine der zukünftigen Herausforderungen ist es, die Biomasse nach ihren Hauptinhaltsstoffen zu trennen. Denn letztlich lassen sich alle in unterschiedliche Chemikalien verwandeln. Je nach Herkunft besteht Biomasse zu unterschiedlichen Anteilen aus der Holzsubstanz Lignin, die sich für Kleb- und Treibstoffe nutzen lässt, der Hemizellulose, aus der der Kunststoff-Vorläufer Furfural synthetisiert werden kann und der Zellulose.
Diese Kohlenhydrate sind in großen Mengen vorhanden und lassen sich unter anderem zu Lösungsmitteln, Alkoholen, Organischen Säuren oder Polymeren, Kunststoff-Molekülen, umbauen. Auch Fette und Eiweiße gehören zu den Biomasse-Bestandteilen, die mit aufwendigen chemischen Verfahren oder durch die Arbeit von Mikroorganismen voneinander getrennt werden müssen. Je unterschiedlicher die Zusammensetzung des Biorohstoffs, desto aufwändiger ist die Aufbereitung.
Allerdings hat die pflanzliche Rohstoffquelle einen großen Vorteil gegenüber herkömmlichen Syntheseverfahren: Viele nützliche Substanzen sind bereits in den Gewächsen enthalten, müssen daher nur noch extrahiert und nicht in komplexen Prozessen aus kleinen chemischen Bausteinen hergestellt werden. In Brandenburg werden vom kommenden Jahr an zunächst vor allem grünes Gras, Luzerne und Klee, aber auch Stroh und Holzreste genutzt, die im Überfluss auf den landwirtschaftlichen Flächen anfallen und sich aus ähnlichen Substanzen zusammensetzen.
Auf einen Rohstoff ganz anderer Art setzt das US-amerikanische Unternehmen Cargill-Dow. Seit wenigen Jahren stellt die Tochter der beiden US-Unternehmen Dow Chemicals und Cargill aus Mais Bio-Kunststoffe her, die sich zu Plastik-Verpackungen wie Folien oder Bechern und sogar T-Shirts verarbeiten – alles biologisch abbaubar. Rund 140.000 Tonnen Öko-Kunststoff kann die Bioraffinerie in Nebraska jährlich herstellen.
Dazu wird die Maisstärke zu dem bekannten Zucker Glukosesirup abgebaut und anschließend in Milchsäure verwandelt. In einer Kettenreaktion verbinden sich die Milchsäurebausteine schließlich zu einem Polymer – zur Poly-Milchsäure (PLA, Poly Lactid Acid).Und die hat es in sich. Immerhin lässt sie sich zu einem Garn spinnen, das ähnlich atmungsaktiv und Wasserdampf-durchlässig ist wie der Stoff von Outdoor-Jacken. PLA-Kleidung geht vor allem in Südost-Asien über die Ladentheke. In Deutschland ist seit kurzer Zeit Bettwäsche aus PLA auf dem Markt. (Vgl. Meldungen vom 2003-05-13 und 2003-01-29.)
Ein Vorteil der PLA-Fasern: Anders als Baumwolle benötigen sie keine Nachbehandlung, um flauschig zu werden – ein Verfahren, bei dem häufig aggressive Chemikalien eingesetzt werden. Freilich ist Mais ein Nahrungsmittel und wird mit viel Dünger und auch Pestizideinsatz zur Reife gepäppelt.
Cargill-Dow pflanzt aber nicht eigens Mais zur PLA-Produktion an, sondern nutzt Agrarüberschüsse, die auf dem Weltmarkt unverkäuflich sind und ansonsten entsorgt oder zu Dumpingpreisen verkauft werden müssten. In den kommenden Jahren will das Unternehmen dennoch vermehrt auf die Nutzung von Ernteabfällen wie Maisstroh setzen. “Die treibende Kraft ist letztlich die Idee, hochwertige Produkte aus jährlich nachwachsenden, überall verfügbaren Rohstoffen zu gewinnen”, sagt Jürgen Klein von Cargill-Dows Europa-Dependance in Naarden bei Amsterdam.
Ein ähnliches Ziel verfolgt Eckhard Dinjus vom Forschungszentrum Karlsruhe. Der Spezialist für Technische Chemie hat ein Verfahren zur Nutzung von Stroh als Energiequelle optimiert. Bisher werden die verdorrten Grashalme an Tiere verfüttert, untergepflügt oder einfach direkt auf dem Feld verbrannt. Nach Dinjus Berechnungen fallen jährlich allein in Deutschland 20 Millionen Tonnen Stroh an, die nicht in der Landwirtschaft benötigt werden. Daraus ließen sich etwa 10 Prozent des heimischen Kraftstoffbedarfs decken. (Vgl. Meldung vom 2002-08-12.)
In einer bislang einmaligen Pilotanlage erhitzen die Karlsruher Forscher Stroh mit heißem Sand auf 500 Grad Celsius. Bei diesem so genannten Pyrolyseverfahren entsteht zunächst ein schwarzes Öl-Koks-Gemisch – das sogenannte Slurry. In einem zweiten Schritt wird das Slurry in Synthesegas gewandelt – das aus den Kohlenstoffbausteinen, etwa Kohlenmonoxid und Wasserstoff besteht. Diese sind der Grundstoff für die Synthese von Kraftstoffen, Methanol und anderen Chemikalien.
Der Vorteil der Methode: Da das leichte und voluminöse Stroh nicht über weite Strecken rentabel transportiert werden kann, lässt es sich zunächst in kleinen Pyrolyse-Anlagen direkt auf dem Lande in die Öl-Koks-Mischung verwandeln. Das kann dann in großen Tankwagen zur Synthesegasanlage gefahren werden.
Auch für feuchte Biomasse, die unter anderem in großen Mengen im Haushalt anfällt, haben die FZK-Chemiker eine Lösung gefunden. Sie verwandeln den Abfall mit überkritischem Wasser bei hohem Druck und Temperaturen um die 600 Grad Celsius. Unter diesen Bedingungen wechselt das Wasser in einen Zustand zwischen gasförmig und flüssig. Es ist dabei äußerst reaktionsfreudig und setzt die Biomasse innerhalb kurzer Zeit vor allem zu Wasserstoff und Kohlendioxid um. Der Wasserstoff entsteht dabei sowohl aus der Biomasse als auch aus dem Wasser. Er eignet sich zum Betrieb von Brennstoffzellen oder eben als Grundstoff für die zukünftige Bioraffinerie.
(Vgl. Meldungen vom 2003-07-03 und 2002-08-16.)
Source
T. Schröder vom 2003-07-18.
Share
Renewable Carbon News – Daily Newsletter
Subscribe to our daily email newsletter – the world's leading newsletter on renewable materials and chemicals